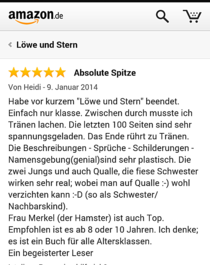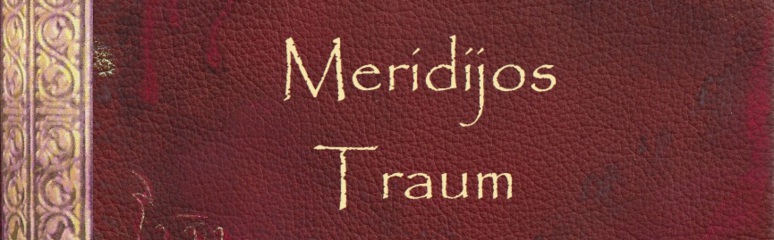
Leseproben
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und würde mich über einen Gästebucheintrag (jegliche Kritik ist immer gern gesehen) sehr freuen!
Inhalt:
I.)Auszug aus dem Kinderbuch "Löwe & Stern"
II.)Zwei Märchen aus dem Buch "Geschichten aus dem Veybachtal"
III.)Auszug aus dem Fantasy-Roman "Das Buch der Flammen - Meridijos Traum"
I.) Leseproben aus "Löwe & Stern"
Kapitel 1
Oliver
|
L |
eise schimpfend watschelte die alte Frau in ihren viel zu großen Gummistiefeln durch das geschwungene schmiedeeiserne Tor. Ein kleiner schwarzer Hund mit flatternden Ohren sprang kläffend hinter ihr her. Sie stampfte die Einfahrt zur Villa hinauf und bei jedem ihrer Schritte erklang ein knirschender Laut auf dem weißen Kieselsteinboden. Mißbilligend die Nase rümpfend betrachtete die Alte den schwarzen Mercedes-Benz, der in der Einfahrt stand. Vor den Stufen zur Haustüre beschrieb der Weg einen Kreis um ein wunderschön bepflanztes Blumenbeet. Wie selbstverständlich trampelte die Frau durch die frisch gepflanzten Blumen, stolperte die Stufen hinauf und rammte ihren wurstartigen Finger gegen den Klingelknopf. Knarxxx! Der Knopf gab ein bedenklich knirschendes Geräusch von sich.
„Oliver, es hat geschellt. Machst du mal bitte die Türe auf?“
„Kla´, Ma.“
„Und hör doch bitte auf mich dauernd Ma zu nennen, o.k.?“
„Na kla´, Ma.“
„Mhmm!“, brummte meine Mutter aus dem Bad während ich mit einem Eimer und einem Putzlappen bewaffnet zu unserer riesigen schnörkeligen Haustür sauste und sie aufriß. Draußen stand eine alte runzlige Frau mit Gummistiefeln und einer ungewöhnlich großen Nase, die ein wenig an Rumpelstilzchen erinnerte. Es war Frau Ihdorf, unsere Nerv-tötende und äußerst neugierige Nachbarin. Sie war so etwas wie die selbsternannte Polizei in unserem Dorf und hielt sich selbst für ungeheuer wichtig. Prüfend steckte sie ihre Finger in die Erde der Blumenkübel.
„Tag Kleiner. Was machst du denn mit dem Putzeimer?“
„Guten Tag Frau Ihdorf. Ich will Papas Auto waschen.“, antwortete ich brav. Die hutzlige Frau schimpfte irgendwas von Kinderarbeit, während sie wie selbstverständlich an mir vorbei durch den breiten Eingangsbereich in Richtung Küche rauschte. Dicht gefolgt von ihrem kleinen, giftig knurrenden Fledermausohrenhund namens Spooky.
„Aber kommen sie doch herein.“, murmelte ich abwesend, während Frau Ihdorf einen Moment lang innehielt, um unser riesiges Treppenhaus zu begutachten. Eigentlich war es gar kein Treppenhaus. Es war eher so eine Art runder Saal an dessen Rückseite sich links und rechts je eine viertelkreisrunde Treppe nach oben wand. Ihre Blicke streiften die geschnitzten Spekulatius-Möbel und die Ritterrüstung zwischen den beiden Treppenaufgängen. Als sie den Kristall-Leuchter an der Decke des Treppensaales erblickte, gab sie einen verächtlich prustenden Laut von sich und stampfte weiter.
„Soll ich meiner Mutter sagen, daß sie da sind?“, wollte ich wissen.
„Laß mal, Kleiner! Ich finde mich in dem Laden hier schon alleine zurecht.“
In dem Laden hier...!, äffte ich die Alte nach, während diese bereits begann, geschäftig in unseren Küchenschränken herumzukramen. Mit einem Rumms flog die Haustür wieder ins Schloß. Ich war zwar erst zehn Jahre alt, doch trotzdem konnte ich es auf den Tod nicht ausstehen, wenn mich jemand „Kleiner“ nannte.
„Wer war es denn?“, fragte Ma, die soeben mit einer Flasche Glasreiniger und einem Tuch in der Hand aus dem Gästebad gewackelt kam.
„Ach, es war nur wieder Frau Ihdorf mit ihrer kleinen sabbernden Kröte. Die beiden sind in der Küche.“ Meine Ma wurde bleich und ließ die Putzsachen fallen.
„WAS??? Warum hast du sie reingebeten?“ Ungläubig betrachtete sie die matschigen Stiefelabdrücke, die die alte Frau auf unserem Marmorfußboden hinterlassen hatte.
„Aber Ma.“, winkte ich ab. „Frau Ihdorf muß man nicht hereinbitten. Die kommt einfach rein.“ Als in der Küche etwas Schweres scheppernd zu Boden fiel und lautstarke Flüche zu hören waren, stürzte Ma hinein und fand dort Frau Ihdorf vor, die mit dem Oberkörper in einem Küchen-Unterschrank verschwunden war.
„Was zum Henker tun sie da???“ Kopfschüttelnd stand ich im Türrahmen und hörte zu, wie sich Frau Ihdorf mit meiner Ma über Flusen im Schrank stritt, als es erneut schellte. Doch diesmal war offenbar der Klingelknopf so tief gedrückt worden, daß er nun feststeckte. Ein kreischendes Schrillen bohrte sich in meine schmerzenden Ohren. Schnell stellte ich den Eimer ab, warf den Lappen hinein und lief zur Türe. Erwartungsvoll riß ich sie auf.
„Na endlich Leon! Da bist du ja!“ Der braunhaarige Junge in den verschlissenen Klamotten vor der Tür starrte mich mit großen Augen an, während die Klingel schrillte und aus der Küche wildes Gezeter zu uns herüberdrang.
„Was soll das denn heißen?“
„Ich dachte schon, du würdest nicht kommen.“
„Beim kybernetischen Cyber-End-Drachen. Glaubst du etwa, ich wollte die Baumhaus-Fertigstellungs-Party verpassen?“, rief er laut und versuchte angestrengt, den Klingelknopf wieder zu lösen. Doch es gelang ihm nicht. „Ihr solltet mal nach eurer Klingel sehen lassen.“
„Du wirst es kaum glauben, aber das hab ich auch schon mitbekommen.“, versuchte ich das Schrillen zu übertönen. Im selben Augenblick erschien Spooky aus der Küche und zog im Rückwärtsgang knurrend ein etwa tellergroßes Stück Fleisch hinter sich her. Dann verschwand er durch die noch immer offene Haustür nach draußen. Verwirrt starrten wir ihm hinterher.
„Na prima.“, seufzte ich. „So viel zum Thema Rinderbraten.“
„Sag mal. Was ist hier eigentlich los?“, wollte Leon wissen und verzog das Gesicht. Das unaufhörliche Schrillen hatte sich mittlerweile zu einem schmerzhaft ohrenbetäubenden Pfeifen verstärkt.
„Ach. Es ist nur wieder Frau Ihdorf.“, brüllte ich und bereitete dem Schellen mit einem kräftigen Schlag gegen den Knopf ein plötzliches Ende.
„Ach so.“, meinte mein Freund erleichtert. Guck mal, ich habe neue Cybyoh-Karten. Willste mal meine zehnköpfige Monsterschwarte sehen? Waschen wir jetzt den Wagen? Von dem Taschengeld kaufen wir dann die letzten Bretter, ja? Ich kann es kaum abwarten, endlich zum Baumhaus zu kommen.“
„Pssst!!! Nicht so laut! Und erwähn nicht das Baumhaus!“
„Was ist denn?“, flüsterte Leon, trat herein und warf seine mit Flicken ausgebesserte Jacke beiseite.
„Qualle.“, flüsterte ich und fegte mir meine strohblonden Haare aus dem Gesicht. Ich bemerkte nicht, daß sich hinter mir die Wohnzimmertüre einen Spalt weit geöffnet hatte.
„Ach du heilige Scheibe nochmal, Oli. Ich dachte, deine fiese kleine Schwester wäre bei ihrer schrecklichen Freundin Trixi. Wollte die nicht da übernachten?“
„Die Freundin hat die Seuche oder so was. Und Qualle ist jetzt im Wohnzimmer und hegt sicher wieder irgendwelche friedhofmonströsen Gemeinheiten aus.“
Unser Wohnzimmer war ein riesiger langgezogener Raum, der ein wenig an einen Rittersaal erinnerte. Dort verkroch sich meine Schwester oft, wenn sie neue Energie für ihre fiesen Streiche tanken mußte. Leon kratzte sich am Kopf und seufzte.
„Laß uns hoffen, daß sie uns diesmal in Ruhe lässt.“ Die Türe schloß sich wieder und ein unmerklicher Schatten huschte vorbei.
„Keine Sorge. Meine Eltern sind ja da. Nich´ wa´, Ma?“, brüllte ich in Richtung Küche. Das Geschimpfe verstummte einen Moment.
„Wie bitte, was?“, kam zur Antwort.
„Ach schon gut. Leon ist da. Wir gehen raus und waschen das Auto.“
„Aber er soll...“
„...bloß nichts Elektrisches anfassen.“, ergänzte ich den ständig wiederkehrenden Satz meiner Mutter.
„Ja kla´, Ma!“ Gut gelaunt tobten wir zur Türe hinaus. Doch dann machte ich kehrt, um den Eimer und die Putzsachen zu holen, die ich im Haus vergessen hatte. Hastig kramte ich aus dem gigantischen schnörkeligen Dielenschrank die Tasche mit den diversen Utensilien hervor, die mein Vater zum Autowaschen benutzte. Mikrofaserhandschuhe war auf der Packung zu lesen. Himmel, was für ein Wort. Solche Wörter dachte sich sonst nur unsere Deutschlehrerin aus. Dann zog ich noch die Shampoo- und Politurflasche hervor. Wo zum Henker hatte ich bloß den Eimer hingestellt? Ich fand ihn vor der Küchentür, warf alles hinein und folgte Leon nach draußen in den Hof. Mein Freund stand beinahe ehrfürchtig vor dem großen schwarzen Auto mit den ebenso schwarzen Ledersitzen und wagte sich kaum, es auch nur zu berühren.
Für mich war der tolle Wagen den mein Vater fuhr und die Villa in der ich lebte nichts Besonderes mehr. Schließlich wohnte ich ja hier. Doch für Leon war das anders. Er lebte mit seinem Vater in einer kleinen engen Reihenhaus-Wohnung ganz in der Nähe. Ein Auto hatten sie auch nicht. Und schon gar nicht so eins.
Heute hatten wir beschlossen, den Wagen auf Hochglanz zu bringen, um unser Taschengeld etwas aufzubessern. Wir wollten davon Bretter für unser Baumhaus kaufen, das bereits kurz vor seiner Vollendung stand. Zugegeben: Ich brauchte auch ein wenig Knete, um Leon ein Geschenk für seinen elften Geburtstag zu kaufen, den er in zwei Wochen feiern würde.
„Na los!“, spornte ich meinen Freund an. „Laß uns anfangen!“ Wir schnappten uns den Gartenschlauch, das Shampoo und die Spezialhandschuhe aus dem Eimer und legten los. Später rubbelten wir den Lack trocken und begannen, den Wagen zu polieren. Währenddessen öffnete sich die Haustüre erneut. Eine wütend schimpfende Frau Ihdorf polterte die Stufen hinab und dampfte davon. Ein ziemlich rund geratener Mann mit Halbglatze und Krawatte erschein im Türrahmen und rief ihr nach:
„Lassen sie sich hier nicht mehr blicken!“. Es war mein Vater. Doch die dunklen Gewitterwolken in seinem Gesicht verschwanden, als er uns beide erblickte.
„Das ist ja phantastisch!“, meinte er mit dem breitesten Honigkuchen-Lächeln. „So wie es aussieht, habe ich wieder mal den glänzendsten Wagen weit und breit.“
Stolz bauten wir uns vor dem Auto auf und öffneten die Türe. Mein Paps ließ sich in den Fahrersitz fallen und klemmte sich hinter das Lenkrad. Dann stutzte er und schnüffelte.
„Was riecht denn hier so seltsam?“ Eine Sekunde später fiel sein Blick auf die seltsamen klebrigen Reste dessen, was offenbar jemand in die Lüftungsschlitze geschmiert hatte. Das ist ja... Schmelzkäse!!!“, rief er ungläubig und funkelte uns wütend an. „Wer zum Teufel war das???“
„Was ist denn nun schon wieder los?“, fragte meine Ma, die mit meiner bösartig grinsenden kleinen Schwester im Schlepptau die Stufen hinunter kam. Mein Schwesterlein hatte ihre blonden Haare zu zwei Zöpfen zusammengebunden, die ihr links und rechts vom Kopf abstanden. Mit ihrem von Sommersprossen übersäten Gesicht sah sie beinahe aus, wie eine Miniaturausgabe von Pipi Langstrumpf. Ich ballte die Fäuste und knirschte:
„Qualle!!!“
„Jemand hat offenbar Schmelzkäse in die Lüftung gesteckt!!!“, tobte mein Vater völlig außer sich. Doch wer jetzt dachte, das wäre schon alles gewesen, der täuscht sich gewaltig. Als mein Vater wieder ausstieg und sich hinten an die Hose seines nigel-nagel-neuen Anzuges fasste, bemerkte er, daß er sich auf einen Schokokuss gesetzt hatte, der auf dem dunklen Sitz vorher nicht zu sehen gewesen war. Mit einem Schlag wich alle Farbe aus meinem Gesicht. Ein matschiger Schokokuss auf Papas geheiligten Autositzen!!! Das bedeutete mindestens 20 Jahre Unkraut-Rupfen und 50 Jahre dreckiges Geschirr spülen. Der Kopf meines Vaters lief dunkelrot an. Wenn er herausfand, wer das getan hatte, würde er ihn ungespitzt in den Boden rammen.
„Wir haben nichts damit zu tun!“, beteuerten wir aus einem Mund und wichen beide einen Schritt zurück. Dabei stießen wir gegen den Eimer, der nun umkippte. Dabei fielen nicht nur die übrigen Lappen und Flaschen heraus, sondern auch eine runde Packung Schmelzkäse, die nun beinahe wie ferngesteuert um uns herumrollte und vor den Füßen meines Vaters zum Stillstand kam. Völlig sprachlos starrten wir uns an und ich wusste, daß Qualle wieder mal gewonnen hatte. Keine Ahnung, wie sie das gemacht hat, aber sie hatte mich wieder mal geleimt. Wie vom Donner gerührt blickte mein Vater erst auf die Käsepackung, dann auf mich.
„OLIVER LÖWE!!!“ Die Scheiben klirrten. Die Bombe ging hoch.
Aber entschuldigt. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Oli. Doch das habt ihr sicherlich auch schon mitgekriegt. War ja nicht zu überhören, oder? Zusammen mit meinen Eltern, meinem 19jährigen Bruder Daniel, meinem Hamster Frau Merkel und meiner 6jährigen Terror-Schwester wohne ich in einem kleinen Ort namens Katzenstein im Veybachtal. Mein liebes Schwesterlein heißt eigentlich Verena. Aber wir nennen sie immer nur Qualle. Mit etwas Phantasie hat sie sogar Ähnlichkeit mit einer. Doch in Wirklichkeit nennen wir sie so, seit ich in Italien einmal von Feuerquallen zerstochen worden bin. Und Verena hatte sich darüber halb totgelacht. Egal was sie auch tut, sie ist zickig und gemein. Leon meinte, sie habe deswegen durchaus etwas mit den fiesen Quallen gemeinsam. Dank Qualle hagelte es für mich Dauerärger am Fließband. Und das obwohl ich mit dem ganzen Käse wieder mal nicht das Geringste zu tun hatte! Genau so wenig, wie mit den soßengefärbten Küchenwänden oder mit dem Porzellan-Puppen-Massaker mit Ketchup letzte Woche. Aber lassen wir das...
Es gibt ja schließlich auch nette Leute in meinem Leben. Leon Stern zum Beispiel. Er ist mein bester Freund, der in allen Lebenslagen selbst den dicksten Ärger mit mir teilt. Er wohnt ein paar Straßen weiter bei seinem Vater. Meine Eltern und mein Bruder mögen Leon sehr. Doch meine Ma hat immer Angst, er könnte wieder eines unserer Elektrogeräte zerlegen. Er hat manchmal so etwas wie eine elektrische Überspannung. Klingt abgehoben, ich weiß. Aber das ist nicht gesponnen. Es gibt Tage, an denen er so was von geladen ist, daß eine Berührung von ihm ausreicht, Geräte kaputt zu machen. Auf die Art hat er uns schon diverse Sicherungen aus dem Stromkasten gesprengt! Einige Videorecorder und DVD-Player hat er auch zerlegt. Und Ma´s Mikrowelle hat er auch auf dem Gewissen. Er hat sie nur angefasst und schon fing sie an, wie wild zu piepen und zu blinken. Sie war leider nicht mehr zu reparieren. Seit dem sagt Ma immer, daß er nichts Elektrisches mehr anfassen soll. Unser Dorf Katzenstein heißt genauso wie die steilen Sandsteinfelsen ganz in der Nähe. Nur eine breite Wiese und der gemächlich dahinfließende Bach trennen unsere Häuser von unserem Lieblingsspielplatz. Denn dort oben, auf den Klippen wachsen knorrige alte Kiefern. Ideal, um dort ein Baumhaus zu bauen. Leon hatte die Idee. Denn überall um uns herum gibt es eine Menge Burgen. Auch zu Füßen der Felsen soll es einmal eine Burg gegeben haben. Doch davon ist heute leider nichts mehr zu sehen. Es heißt, daß ein Bagger vor zwanzig Jahren zufällig auf Grundmauern und die Reste einer Treppe gestoßen sei. Doch man hat alles wieder zugeschüttet. Trotzdem hat die Gegend rund um die Klippen etwas Faszinierendes, manchmal sogar Unheimliches an sich. Man erzählt sich, daß unser Tal seinen Namen von den Veyen, den Feen haben soll, an die die Leute hier vor tausend Jahren oder so geglaubt haben. Hier in diesem Wald sollen sie gewohnt haben. Natürlich haben wir beide nicht an so etwas geglaubt. Bis zu jenem Tag. Bis dahin waren wir eigentlich ganz normale Jungs mit ganz gewöhnlichen Hobbys. Wir gingen zur Schule, wie alle anderen auch und das Höchste für uns waren die schulfreien Tage.
So kommt es dann auch, daß diese Geschichte ganz gewöhnlich und unspektakulär beginnt. Man könnte anfangs noch meinen, es handle sich um eine alberne Kindergeschichte. Doch das wird sich schon sehr bald radikal ändern. Es gibt Kapitel, die zugegeben fast zu komisch sind, um wahr zu sein. Doch es gibt auch Stellen, die man nur mit über den Kopf gezogener Bettdecke lesen will. Wenn du also schwache Nerven haben solltest, solltest du in der Mitte des Buches besser aufhören zu lesen.
Es ist schon seltsam. Jeder Junge träumt doch insgeheim davon, einmal der Held eines Abenteuers zu sein, oder? Besonders dann, wenn sein wirkliches Leben trist und traurig ist. Bei meinem besten Freund Leon war das so. Doch wenn man dann tatsächlich in ein solches Abenteuer hineingerät, wünscht man sich plötzlich wieder an den Punkt zurück, an dem alles begonnen hat. Zu jenem Punkt, an dem man wieder ein ganz gewöhnliches Kind ist, wie jedes andere auch. Dieser Punkt war unten im Hof, als wir den Ärger für etwas kassierten, das wir gar nicht getan hatten. Hätten wir gewußt, was nur ein paar Wochen später auf uns zukommen würde, wir wären sicherlich nicht in Urlaub gefahren, sondern zu Hause geblieben. Denn daß ich aus diesem Albtraum nur knapp mit dem Leben davon gekommen bin, habe ich allein Leon zu verdanken. Doch um zu verstehen, was geschehen ist, müssen wir an genau diesem Punkt anknüpfen.
II.) Geschichten aus dem Veybachtal - Märchen für Kinder
Geschichten aus dem Veybachtal
-Der kleine Maulwurf-
(c) Thorsten Fitzner
Einst vor langer Zeit, als die Menschen noch an Märchen glaubten, da lebte im Veybachtal ein kleiner Maulwurf.
Die Tiere des Waldes versammelten sich regelmäßig auf einer großen Lichtung im Hombusch. Dort wurde Rat gehalten und Recht gesprochen. Der Hirsch war der selbsternannte König des Waldes und jeder
hatte seinen Anordnungen folge zu leisten. Jedes Tier mußte je nach Fähigkeiten seinen Teil zum Wohlergehen der Gemeinschaft beitragen. Das Eichhörnchen konnte besonders gut bis in die höchsten und
entlegensten Baumwipfel klettern, um dort Früchte, Nüsse und Eicheln zu sammeln, die den Tieren im Winter als Nahrung dienten. Das schlaue Wiesel fand selbst für die unüberwindlichsten Probleme
eine Lösung. Die Vögel des Waldes sammelten Federn und Fellbüschel, um damit die Schlafplätze der Tiere auszupolstern. Die Wildschweine sammelten Schnecken und Kastanien. Der Eichelhäher hielt
Wache und schlug sofort Alarm, wenn Gefahr im Verzug war. Der Hirsch thronte auf seiner Lichtung und erteilte Befehle. Nur der blinde Maulwurf hatte offenbar keine Fähigkeiten, mit denen er sich
einen Platz in der Gemeinschaft der Tiere hätte verdienen können. Die anderen Tiere mochten ihn nicht, weil er klein und häßlich war. Manche lachten sogar über ihn, weil er blind war und sein Leben
in Dunkelheit unter der Erde verbringen mußte. Wenn der Maulwurf auch an den Versammlungen oder Feierlichkeiten teilhaben wollte, wurde er vom hochmütigen Hirsch weggeschickt. Er habe schließlich
nichts dazu beigetragen. Es war ein einsames Leben, das der kleine Maulwurf führen mußte. So groß seine Anstrengungen auch waren, niemand wollte etwas mit ihm zu tun haben. Er versuchte, wie
das Eichhörnchen, auf Bäume zu klettern. Doch schon der Versuch scheiterte kläglich. Als er sich bemühte, Federn zu sammeln, wehte sie der Wind davon. Bei dem Versuch sie wiederzufinden,
verirrte sich der arme Maulwurf so sehr, daß er Tage brauchte, um wieder nach Hause zu finden. Die übrigen Tiere sahen nur lachend zu oder schüttelten verständnislos den Kopf. Schließlich
stolzierte der Hirsch hinzu und sagte, der Maulwurf solle wieder dort hin zurückkehren, wo er hingehöre. Er solle wieder zusammen mit den Würmern in der schmutzigen Erde graben und die wichtige
Arbeit den richtigen Tieren überlassen. Das machte den kleinen Maulwurf sehr traurig. War er denn kein richtiges Tier?
Ein Sommer kam, ein Winter ging und ein Jahr lang hörte und sah niemand mehr etwas von dem kleinen Maulwurf. Die Tiere hatten ihn schon fast völlig vergessen, als im folgenden Sommer die Sonne so
erbarmungslos vom Himmel brannte, daß Teiche und Seen nur noch wenig Wasser führten. So begab es sich, daß im Wald ein gewaltiges Feuer ausbrach. Die Tiere drängten sich voller Angst zusammen und
wußten vom Rauch eingehüllt nicht, in welche Richtung sie fliehen sollten. In ihrer Furcht suchten sie den Rat ihres Königs. Doch dieser war bereits geflüchtet und hatte die Tiere sich selbst
überlassen. Der stets so hochmütige Hirsch hatte sie alle im Stich gelassen. Das Eichhörnchen kletterte auf den höchsten Ast und erkannte mit Schrecken, daß das Feuer sie eingeschlossen hatte.
Als der Eichelhäher versuchte, über die lodernden Flammen hinweg zu fliegen, mußte er wegen der ungeheuerlichen Hitze umkehren. Die Flammen rückten immer näher und der Rauch wurde immer dichter.
Selbst das schlaue Wiesel wußte gegen diese Bedrohung nichts auszurichten. Als schon alle Hoffnung verloren war, geschah etwas, womit die Tiere nicht gerechnet hatten. Vom Wehgeschrei angelockt stand
plötzlich der Maulwurf zwischen den jammernden und flehenden Tieren. Ohne zu zögern führte er sie durch den zähen Rauch in eine nahegelegene Senke, denn er fand sich auch zurecht, ohne etwas sehen zu
können. Dort verbarg sich zwischen Farnen und Bäumen ein kleines hölzernes Tor. Als der Maulwurf das Tor öffnete, erblickten die Tiere einen unterirdischen Gang, der groß genug war, um einen
wilden Eber hindurch zu führen. Er zündete für seine Gäste eine Fackel an und ging voraus. Ängstlich folgten ihm die Waldbewohner. Doch ihre Furcht wich schnell Begeisterung, denn der Maulwurf
führte sie in sein unterirdisches Reich. Dort gab es große Hallen, hohe Säulen, einen geschmückten Saal, gedeckte Tafeln und weiche Schlafstellen. Dort blieben sie eine Nacht und als der
Maulwurf sie an anderer Stelle wieder an die Oberfläche führte, fanden sich die Tiere an den kühlen Ufern des Veybaches wieder. Dankbar und jubelnd hoben die Tiere den Maulwurf in die Höhe und
kehrten mit ihm zusammen zur Lichtung zurück. Doch groß war ihr Entsetzen, als sie nur noch verkohlte und schwelende Baumstümpfe vorfanden. Zu ihrer Verwunderung hatte sich auch der Hirsch wieder
eingefunden, welcher auch sogleich geschäftig begann, Befehle zu erteilen. Doch die Tiere hatten nicht vergessen, daß sie von ihrem König in der Stunde größter Not verlassen worden waren. Sie jagten
ihn kurzerhand davon und wählten einen neuen König. Derjenige mit den wichtigsten Fähigkeiten sollte ab jetzt im Veybachtal regieren. Doch sie wählten nicht das schlaue Wiesel oder das flinke
Eichhörnchen. Sie wählten den Maulwurf. Denn er hatte von allen die wichtigste Eigenschaft bewiesen: Treue und Zuverlässigkeit selbst in Momenten größter Gefahr. Er hatte sie alle vor dem Feuertod
errettet. Und nun folgten die Tiere der ersten Anweisung ihres neuen Königs. Eifrig trugen sie kleine Baumsetzlinge aus den benachbarten Wäldern herbei, welche der kleine Maulwurf im verbrannten
Hombusch wieder einpflanzte. Denn vom Graben verstand er eine ganze Menge.
-Ende der Geschichte-
Geschichten aus dem Veybachtal
-Die kleine Eiche-
(c) Thorsten Fitzner
Einst vor langer Zeit, als die Menschen noch an Märchen glaubten, da wuchs im Veybachtal eine junge Eiche. Ganz in der Nähe der Katzensteine soll sie gestanden haben und anfangs sah es ganz so
aus, als würde auch sie zu einem jener mächtigen Bäume heranwachsen, die das Tal seit Jahrtausenden bewachsen. Wenn sich früh am Morgen die Nebel lichteten, wetteiferten die anderen jungen
Bäume miteinander, wer seine Blätter am höchsten zur Sonne recken konnte. Sie alle wollten so schnell wie möglich so groß und prächtig werden, wie die anderen Eichen im Wald. Doch die kleine Eiche
dachte gar nicht daran, möglichst schnell groß zu werden. Der junge Baum wollte viel lieber den Waldboden erkunden, aus dem er gewachsen war und mit den lustigen Käferkindern spielen, die zu seinen
Wurzeln umherkrabbelten.
So wuchs er bald hier, bald dort hinüber, um sich alles genau anzusehen. So groß war seine Neugier. Sehr zum Unmut der übrigen Bäume. Sie schimpften ihn aus und verspotteten ihn wegen seines krummen
Stammes und seiner schiefen Zweige. Aber der kleine Baum gefiel sich so wie er war. In seinen gewundenen Ästen spielten die Käferkinder verstecken und ihre kleinen Krabbelfüße kitzelten
die Eiche. Oft erklang ihr borkiges Lachen im Wald dieser Tage.
Die anderen Bäume jedoch beschlossen, daß die kleine Eiche eine Schande für den Wald sei und beschimpften und verspotteten sie nun noch mehr. So sehr, daß der junge Baum sehr traurig wurde. Tag ein,
Tag aus verhöhnt und ausgelacht zu werden hatte ihn letztendlich krank gemacht. Man hatte ihm eingeredet, daß er schlecht sei, unnatürlich und häßlich. Keiner der anderen Bäume wollte mehr etwas mit
der kleinen Eiche zu tun haben. Dabei hatte sie doch gar nichts Böses getan.
Sie blickte an sich herab und begann ihre gewundenen Äste zu hassen. Wenn sie doch nur so aussehen könnte, wie all die anderen, dann würden sie die großen Bäume sicher wieder mögen. So beschloss die
Eiche ab sofort so schön und groß zu werden, wie es die anderen waren. Sie reckte ihre Blätter hinauf zur Sonne und versuchte, ihre Äste geradezubiegen. Doch es war zu spät. Sie war bereits zu alt
geworden und ihre Borke zu hart. Als die anderen Bäume sahen, wie sich die kleine Eiche vergeblich bemühte, lachten sie noch mehr. Verzweiflung übermannte den krummen Baum. In einem Wald voller
Eichen fühlte er sich grenzenlos allein und einsam. Er hätte alles dafür gegeben, um wie die Anderen zu sein. Wie gerne hätte er sich verbogen und gewunden, wenn er dadurch einen Freund hätte
gewinnen können.
Der alte tausendjährige Großvaterbaum bemerkte dies und begann sich um die kleine Eiche zu kümmern. Er war nicht nur der Einzige, der Verständnis zu haben schien. Er war auch der Einzige, der
wundersame Geschichten zu berichten wusste. Er erinnerte sich an Zeiten, in denen seltsame Wesen, die sich selbst Menschen nannten in den Wald eingefallen waren wie die Ameisen. Damals hatten sie
begonnen, die roten Felsen zu fressen. Nach und nach hatten sie große Blöcke herausgebissen und fortgeschafft. Doch der Fels war stärker gewesen und die Menschen waren schließlich wieder
verschwunden. Der alte Großvaterbaum riet der kleinen Eiche, stark zu sein und hart wie der Fels. Dann könne ihr nichts und niemand etwas anhaben. Die Eiche war sehr dankbar, wieder einen Freund zu
haben und versuchte den Rat des Alten zu befolgen.
Doch als der nächste Herbst kam, geschah ein furchtbares Unglück.
Die Wesen, von denen der alte Baum berichtet hatte, waren am frühen morgen in den Wald eingedrungen und hatten alle Bäume gefällt.
Nur die gewundene Eiche hatten sie stehen gelassen. Die Menschen, die die geraden Stämme als Baumaterial benötigten, konnten mit dem krummen Stamm nichts anfangen. Voller Angst blickte sich die Eiche
um. All die mächtigen Bäume lagen am Boden und auch sein Freund der Großvaterbaum war tot. Gefallen im Morgenrot des jungen Tages. Die Menschen schafften die Stämme fort. Dann wurde es still.
Die Eiche weinte dunkles Harz und beschloss von nun an nicht mehr zu wachsen. Sie verlor all ihre Blätter und als schließlich der Winter kam, dachte sie, sie müsse sterben. Eisige Stürme fegten
über die kahle Ebene, die einst eine sonnige Lichtung gewesen war. Schnee und Frost zerrten an den Ästen der Eiche. Doch von all dem bemerkte sie nichts, denn sie war in einen tiefen Schlaf
gefallen.
Lange Zeit hatte sie geschlafen.
Doch plötzlich hörte sie eine Stimme.
„Du mußt blühen, kleine Eiche! Blühe!“
„Wer bist du?“, fragte die Eiche verwundert. Und die Stimme antwortete:
„Ich bin der Frühling, der Sommer, der Herbst und der Winter. Ich bin der Geist allen Lebens auf dieser Welt. Gib nicht auf! Lebe und ich werde dich reich belohnen.“
Als die Eiche erwachte, dachte sie, sie habe nur geträumt. Doch es war kein Traum gewesen. Der Frühling hatte über den Frost gesiegt und die kahle ebene in ein Meer aus Blumen verwandelt. Als die
Eiche um sich herum all die Blumen sah, regte sich wieder Freude in ihrem Herzen und so beschloß auch sie zu blühen.
Im Laufe des Jahres reiften viele Eicheln heran. Und im nächsten Jahr, nachdem alle Eicheln zu Boden gefallen waren, wuchsen aus ihnen viele kleine Eichen heran.
Bewundernd blickten die winzigen Bäume hinauf zur großen Eiche und versuchten, ihre kunstvollen Windungen nachzuahmen.
Die kleinen Bäume liebten die Eiche sehr und da sie es nicht anders wussten, wuchsen sie alle zu prächtigen, gewundenen Bäumen heran.
Die alte Eiche jedoch lebte so noch viele Jahrhunderte glücklich und zufrieden umringt von ihren Kindern und Kindeskindern. In einem Wald voller Eichen war sie fortan nie mehr alleine. Und wenn
du reinen Herzens bist und mit offenen Augen durch den Wald gehst, so könnte es sein, daß du ihr noch heute begegnest.
-Ende der Geschichte-
III.) Leseprobe aus "Meridijos Traum" (ab 16 Jahren)
"Meridijos Traum" handelt von einem Wesen, das in einer Phantasie-Welt lebt, welche ohne nennenswerte Emotionen auskommt. Doch Meridijo passt in keinerlei Hinsicht in diese Welt, denn er ist nicht nur fähig, Gefühle zu empfinden, ihn umgibt ein dunkles Geheimnis. Er ist ein Khorún, ein Wesen, das durch extreme Gefühlsausbrüche wie Wut und Trauer Naturgewalten zu entfesseln vermag. Eine Gabe, die sich finstere Mächte nutzbar machen wollen. Doch darf man nichts gegen Meridijos freien Willen tun, um nicht dessen unkontrollierbare Kräfte zu provozieren. So beschließt man, ihn mit seinem größten Traum zu ködern. Einem Leben in Frieden und Harmonie. Doch wie stellt man es an, ein solches Wesen für das Böse zu gewinnen?
Eine Geschichte voller tiefer Emotionen, Träume, Täuschung und Verrat.
- Prolog -
Aus dem Fantasy-Roman „Das Buch der Flammen- Meridijos Traum“
(c) Thorsten Fitzner
Die Nacht legte sich über das Zeltlager. Nervös ging Merael in seinem Zelt auf und ab. Die Kerzen waren fast heruntergebrannt und tauchten das riesige, sonst strahlendweiße Zelt in diffuses Licht.
Der Nuúrj umrundete den großen Kartentisch, dessen zierliche ineinandergeschlungene Beine durch das flackernde Licht auf gespenstische Art wie zum Leben erweckte Schlangen wirkten. Die Glieder seines
Kettenhemdes klirrten bei jeder seiner angespannten Bewegungen. Er verharrte, vor seinem Spiegelbild auf dem blankpolierten Harnisch, welcher auf einem eigens dafür vorgesehenen Holzständer darauf
wartete angelegt zu werden. Merael war alt geworden, gewiss. Schwere Zeiten wie diese hinterließen stets ihre Spuren. Sein ungewöhnliches Antlitz war durch die vielen Narben entstellt, alte wie
frische. Sein Haupt war kahl und der Nacken von langen, eng anliegenden dunkelblauen Federn bedeckt, die wie ungewöhnliches Haar auf seine Schultern fielen. Seine schlitzartigen Nasenöffnungen
befanden sich in Höhe der Stirn und in seinem ungewöhnlich großen Mund verbargen sich glasklare lange Zähne. Augen waren nicht zu erkennen und seine riesigen, den Körper annähernd umschlingenden
Schwingen berührten fast den Boden. Trotz der Müdigkeit strahlte er die Weisheit vieler Jahrhunderte aus. Einer seiner beiden dunkelblaugefiederten Flügel war seit dem letzten Gefecht verkrüppelt und
Sorgenfalten hatten sich tief in seine schuppige Haut gegraben. Mißmutig wandte er sich ab und blickte offenbar auf seine ebenfalls vernarbte Hand, die ein zerknittertes Schriftstück fest umschlossen
hielt. Vor Anspannung traten die Fingerknochen am Handrücken hervor wie Dornen und seine Krallen bohrten sich in das Pergament. Insgeheim hatte er es befürchtet, doch hätte er es sich selbst niemals
eingestanden:
Das Undenkbare war geschehen. Das ruhmreiche Heer der Nuúrj, seines Volkes, war an allen Fronten vernichtend geschlagen worden. Nun standen sie am Rande des Abgrundes, aus dem es keine Wiederkehr
geben würde. Niemals hatte es ein Zeitalter ohne sie gegeben. Stets hatten sie, das Sturmvolk, das es von Anbeginn der Zeit gegeben hatte, die Geschicke der Welt zum Guten gewendet. Legendär waren
ihre Taten. Ihre Tapferkeit suchte ihresgleichen. Doch nun hatte sich das Schicksal gegen sie gewendet. Seit sich der Schatten Darcghors über Esthrael den Auserwählten gesenkt hatte, war ihr
Niedergang und mit ihnen der Niedergang der Welt nicht mehr aufzuhalten gewesen.
„Esthrael, du fehlst uns!“
Merael vergrub einen Augenblick das Gesicht in seinen Händen und seufzte tief.
Plötzlich und ohne Vorankündigung stürmte jemand in das Zelt des Feldherrn.
„Merael!“
Erschrocken fuhr der Heerführer herum. Erleichtert erkannte er die kraftvolle Gestalt Ghrimbuthan Graubarts, des Fürsten der Bhricc, des stolzen Zwergenvolkes aus Thûrdahl unter der
Himmelssäule.
„Ist es wahr?“, prustete der Zwerg. Sein kunstvoll geflochtener grauer Bart wirbelte herum, als er vor den riesigen Nuúrj trat. Sein scharfer Blick unter den ebenso geflochtenen langen Augenbrauen
musterte sein Gegenüber besorgt. Merael antwortete nicht. Seine mächtigen Flügel hingen kraftlos herab. Sein Gesicht war ausdruckslos. Nur die Schatten der flackernden Kerzen huschten über sein
Antlitz. Schatten, die langsam Besitz von ihm zu ergreifen schienen. Ghrimbuthan erkannte, daß die Lage sehr ernst sein mußte. So hatte er den als unbezwingbar geltenden Heerführer noch nie zuvor
gesehen. Stumm lehnte der Bhricc seine scheinbar viel zu große Streitaxt gegen den Tisch. Sein Blick fuhr Meraels schuppigen Arm herab und blieb an dem Pergament hängen. Wortlos stampfte er auf ihn
zu und entriss ihm das Schriftstück. Ungläubig las er, was dort geschrieben stand, ballte wortlos seine Rechte zur Faust und zerdrückte das Pergament als ob er ein Insekt zu zerdrücken versuchte.
Grimbuthan ging langsam einige Schritte rückwärts und ließ sich auf einen Klapphocker fallen, welcher unter dem Gewicht des Zwerges ächzte. Betretenes Schweigen machte sich breit.
„Wie ist das möglich?“, hauchte er schließlich. „Wir waren unbesiegbar! Niemand konnte unserem Bündnis widerstehen. Wie konnte ein zum Monster herangewachsenes Kind solche Macht erlangen?“
Merael wandte sich seinem Gegenüber zu und obwohl er die Augen des Nuúrj nicht sehen konnte, spürte der Zwerg deutlich seinen Blick.
„Wir wissen nun, woher er seine Kraft bezieht.“
Der Bhricc sah ihn fragend an und Merael fuhr fort:
„Er steht mit einer Macht im Bunde, die die Menschen die schwarze Flamme nennen.“
„Bei Uuodan!“, entfuhr es dem Bhricc. „Soll das bedeuten...“, er schüttelte ungläubig den Kopf, „...daß diese Flamme das Gegenstück von Ardaríjn sein könnte?“
„Ja.“, entgegnete der Heerführer knapp und wandte sein Gesicht der Dunkelheit zu. „Unser Feind Scargorocc ist nun für die Schatten zu dem geworden, was Esthrael für uns gewesen ist. Er ist ein Khorún
seiner Flamme.“
Der Bhricc seufzte, besah sich das Pergament und erhob sich. Die Glut in seinen Augen war noch nicht erloschen und so sprach er mit fester Stimme:
„Wie Esthrael, ist auch er nicht unsterblich! Wir werden ihn zerquetschen wie ein jämmerliches Insekt, das es nicht zu leben verdient! Mit der Menschenbrut und diesen schwarz brennenden
Darcghor-Dämonen werden wir schon fertig!“
„Ghrim, das war noch nicht alles.“, setzte Merael an. „Wir haben es nun nicht mehr mit einem Scargorocc zu tun. Vielmehr sind es Legionen, gegen die wir nun zu kämpfen haben.“
Der Bhricc sah ihn verständnislos an:
„Was soll das heißen?“
„Durch verderbte Zauberei ist es ihm gelungen, Abbilder seiner selbst zu erschaffen, die allesamt mit derselben Macht und Grausamkeit ausgerüstet zu sein scheinen, wie er selbst. Offenbar traut er
nur noch sich allein und er breitet sich aus, wie die Pest. Das ist auch der Grund, warum der Feind uns an immer neuen Fronten angreift. So hat er es geschafft unsere sonst so unüberwindliche Einheit
zu zerstören.“
Fassungslos vernahm der Bhricc die Worte, die er niemals für möglich gehalten hätte.
„Jetzt wird klar, wie es möglich gewesen ist, daß er selbst jedes seiner Heere an allen Fronten gleichzeitig anführen konnte.“, brummte Grimbuthan und begann ungestüm im Zelt umherzulaufen. „Wir
müssen sofort handeln! Wir müssen uns mit den Resten der versprengten Heere vereinen! Nur so haben wir noch eine Chance.“
„Ghrim...“
„Wir werden sie zertrampeln wie Wanzen, wie aussätzige Maden!“
„Ghrim!“
„Was?“
„Es ist niemand mehr am leben, mit dem wir uns noch vereinigen könnten.“
Der Bhricc sah in Meraels müdes Antlitz und erschrak. Es schien, als sei jeglicher Lebenswille aus ihm verschwunden.
„Aber...“, zum ersten Mal in seinem langen Zwergenleben rang der sonst so schlagfertige Fürst nach Worten. Wenn Merael, der Stärkste unter den Starken, der Unerschrockenste unter den Tapfersten, wenn
er keinen Ausweg mehr sah, dann mußte dies wahrhaft das Schlimmste bedeuten. So sprach er mit bebender Stimme:
„Woher... weißt du das?“
„Der von Pfeilen zerpflügte Bote... Es war Túcor, meines Bruders Sohn.“ Im Gesicht des Bhricc spiegelte sich Entsetzen wider. „Bevor er sein Leben aushauchte, berichtete er, daß der Feind alle
Kriegsgefangenen töten ließ. An allen Fronten entbrannte ein gewaltiges Blutbad. Sie wurden förmlich überrannt. Außer ihm hat niemand überlebt. Es geht nicht mehr nur um den Sieg und unsere
Unterjochung, es geht um unsere völlige Vernichtung.“ Der Heerführer schwieg einen Moment, zog sein silbernes Schutzamulett vom Hals und legte es auf den Tisch. „Als Túcor zu uns durchbrach, hatte
Scargoroccs neue Legion uns bereits annähernd umringt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er uns erreicht.“
Ghrimbuthan nahm den reich verzierten kantigen Helm ab und schwieg. Er wußte sehr genau, was dies zu bedeuten hatte. Ihr zerschundener Trupp aus annähernd fünfhundert teils Schwerverletzten und einer
Hand voll Kampftauglichen hatte gegen einen solchen Ansturm nicht die geringste Chance.
Zwei der Kerzen verloschen und Dunkelheit breitete sich aus. Im Schein der verbliebenen Kerze trat Ghrimbuthan langsam auf Merael zu und sprach mit ruhiger Stimme:
„Wir haben viel gemeinsam erlebt, mein Freund.“ Der Heerführer nickte bedächtig. „Viele Darcghor-Schädel haben wir gespalten und die elende Menschenbrut zurückgedrängt in ihre Höhlen aus denen sie
gekrochen waren.“ Ghrimbuthan blickte fassungslos zu Boden „Wie nur konnte es so weit kommen?“ Einen Moment lang herrschte völlige Stille.
„Ein Funke der schwarzen Flamme im Herzen eines einzelnen Menschen reichte aus, unsere Welt in den Abgrund zu stürzen. So hat es begonnen. Und so wird es nun enden. Ich befürchte, dies ist unsere
dunkelste Stunde.“, sprach Merael schließlich mit gedämpfter Stimme. Der Bhricc schluckte schwer und erwiderte zögerlich:
„Das Schlimmste daran ist, daß alles mein Verschulden ist. Ich... ich hätte ihm niemals Nh´adzijár überlassen dürfen. Zu groß war meine Gier... Ich kann es selber nicht begreifen. Wie konnte ich nur
so dumm sein? Wir hätten ihn besiegt, wäre ich nicht so unendlich töricht gewesen. Nun ist alles verloren. Diese Schuld lastet auf meinen Schultern wie Blei und sie wird schwerer mit jeder
dahingeschlachteten Seele.“
Der Nuúrj sah ihm in die Augen:
„Du hast versucht, deinen Fehler wieder gut zu machen. Manche erkennen ihre Fehler ein Leben lang nicht. Du hast wahrhaft tapfer gekämpft, du und dein Volk. Doch nun müssen wir erkennen, daß unser
aller Ende gekommen ist.“
Die letzte Kerze begann zu flackern.
„Ich habe uns ins Verderben geführt.“, sprach Grimbuthan leise. Eine dicke Träne rann dem Zwerg über die Wangen und sickerte in seinen langen Bart. Verschämt drehte er sein Haupt zur Seite.
Anerkennend legte Merael seine riesige Hand auf die Schulter des Bhricc. Nie zuvor hatte er einen Zwerg Tränen vergießen sehen.
„Gräme dich nicht. Auch dazu gehören Mut und Stärke.“ Ghrimbuthan entgegnete nichts.
Stille herrschte. Nur das leise Stöhnen der vielen Verwundeten vor dem Zelt war zu hören. Schließlich fragte Merael:
„Wenn das letzte Licht unserer Welt verlischt, wirst du dann an meiner Seite stehen, mein treuer Freund?“
„Ja!“, antwortete der Bhricc mit fester Stimme. „Ja, das werde ich! Bis zum letzten Atemzug! Wenn es schon keine Hoffnung mehr gibt, dann werde ich zumindest so viele dieser Bastarde mit in den Tod
reißen, wie ich nur kann!“
Auch der letzte Rest der verbliebenen Kerze war nun heruntergebrannt und die Finsternis umhüllte sie. Plötzlich ertönte ein Horn und sogleich herrschte vor dem Zelt ein großer Tumult. Man hörte viele
raue Stimmen und Waffen klirren.
„Es ist soweit Grimbuthan Graubart. Es ist soweit.“